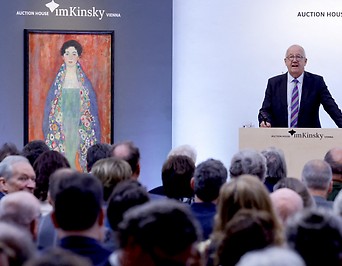Wahlbetrug: Trump-Vertraute Giuliani und Meadows angeklagt
Im US-Bundesstaat Arizona müssen sich Vertraute des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen möglichen Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 vor Gericht verantworten.
Sie sollen sich der Verschwörung zur Wahlmanipulation schuldig gemacht haben, indem sie sich unter anderem als Wähler ausgaben, um Trumps Wiederwahl 2020 zu ermöglichen, heißt es in der gestern veröffentlichten Anklageschrift.
Unter den Angeklagten sei auch Trumps Anwalt Rudy Giuliani, räumte dessen Sprecher Ted Goodman ein. Sein Name sowie die Namen von sieben weiteren Angeklagten seien bis zur Zustellung der Anklageschrift geschwärzt, erklärte die Generalstaatsanwältin von Arizona.
Insgesamt 18 Angeklagte
Einer der Angeklagten wird in den Gerichtsdokumenten als Stabschef im Jahr 2020 aufgeführt – eine Position, die zu diesem Zeitpunkt Mark Meadows im Weißen Haus innehatte.
In den Gerichtsdokumenten wird auch ein „ehemaliger US-Präsident“, Trump, als nicht angeklagter Mitverschwörer der insgesamt 18 Angeklagten aufgeführt. Vertreter von Meadows und Trump reagierten nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.
Höchstgericht verhandelt über Trumps Immunität
Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich heute in einer Anhörung mit dem Antrag von Trump, ihm „absolute präsidentielle Immunität“ gegen strafrechtliche Verfolgung zu gewähren. Trump argumentiert, Präsidenten seien in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt, wenn sie spätere Strafverfolgung fürchten müssten. Ein Berufungsgericht hatte Trumps Antrag im Februar verworfen.
Die bis etwa Ende Juni erwartete Entscheidung des Supreme Court könnte Auswirkungen auf einen Teil der gegen Trump erhobenen strafrechtlichen Anklagen haben. Sein Immunitätsantrag führte bereits zur Aussetzung seines ursprünglich für Anfang März angesetzten Prozesses vor einem Bundesgericht in Washington. Darin geht es um Trumps Versuche, seine Wahlniederlage gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden zu kippen.