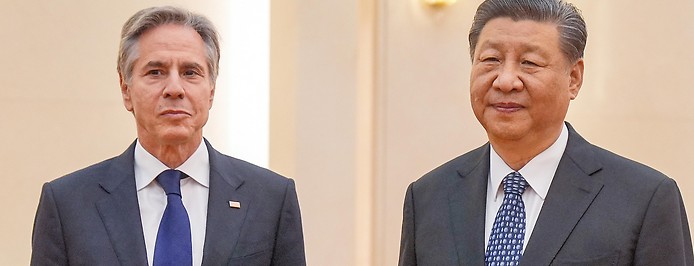Die SPÖ hat nach einigem Überlegen eine Bundesliste für die Nationalratswahl gefunden. Der heute vorgelegte Personalvorschlag fand in den Gremien einstimmig Anklang, wie Parteichef Andreas Babler berichtete.
Er selbst führt das Kandidatenfeld vor der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures und FSG-Chef Josef Muchitsch an. Auf Kampfmandate platziert wurden der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Paul Stich, und der Chef der LGBTQ-Organisation SoHo, Mario Lindner.
„Jüngste Liste ever“
In einer Pressekonferenz nach den Sitzungen von Präsidium und Vorstand sagte Babler, dass es sich bei den ersten zehn um die „jüngste Liste ever“ mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren handle.
Man habe die „besten Köpfe“ gefunden, war der Parteivorsitzende überzeugt. Babler sagte, „doch einigen“ Gestaltungsspielraum bei der Erstellung der Liste gehabt zu haben. Den habe er auch genützt.
Formal beschlossen wird die Liste morgen an einem „kleinen Parteitag“, dem Bundesparteirat, der diesmal in Wieselburg stattfindet. Dort werden auch die Länderlisten angenommen.
Fünf, sechs Mandate über Bundesliste
Gerechnet wird damit, dass die SPÖ in etwa fünf Mandate über die Bundesliste erringt, ein sechstes könnte möglich sein. Das erste geht an Parteichef Babler, der in Niederösterreich nicht aufgestellt wurde und somit das Bundesmandat braucht.
Dagegen benötigen die auf Platz zwei (Bures/Wien), vier (Frauenchefin Eva Maria Holzleitner/Oberösterreich) und fünf (Klubobmann Philip Kucher/Kärnten) vorgesehenen Kandidaten und Kandidatinnen keinen Bundessitz, da sie in den jeweiligen Ländern abgesichert sind.
Somit erhalten der auf Rang drei gereihte FSG-Chef Muchitsch, die auf Position sechs nominierte stellvertretende Klubobfrau Julia Herr, der Vorsitzende der Gewerkschaft Pro-Ge, Reinhold Binder (sieben), und die Salzburger Abgeordnete Michaela Schmidt (acht) Plätze, die aller Voraussicht nach für einen Einzug in den Nationalrat reichen.